






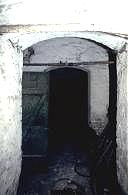
Ein konkreter Hinweis betraf die
Brauerei in dem kleinen Stadtteil Ponarth im Süden der Stadt. Danach
sollten die Kisten mit dem Bernsteinzimmer in den mehrgeschossigen
Kelleretagen der Brauerei untergebracht worden sein. Doch in Ponarth
gab es zwei Brauereien:
Die Actien-Gesellschaft Brauerei
Ponarth in der Tuchmacherstraße 20-22 und die Actien-Brauerei
Schönbusch, Schönbuscher Straße 1-5.
Einer Mitteilung in der englischen
Zeitung "The Sunday Times" vom 24. August 1969 zufolge sollte
es sich um die Brauerei Schönbusch handeln. Der ehemalige Direktor,
ein gewisser Franz Pohlenz, soll dieses Geheimnis seinem Neffen
hinterlassen haben, der es dem englischen Korrespondenten mitteilte.
Die Schönbusch-Brauerei lag westlich
der Eisenbahnlinie Königsberg-Berlin und hatte ein direktes
Anschlußgleis an diese Strecke, was sie als Lager und als
Umschlagplatz für Güter geeignet machte. Der Leser eines von uns
veröffentlichten Berichtes über den Stand der Suche nach dem
Bernsteinzimmer teilte mit, er habe in Ponarth gewohnt und 1945 als
Zwölfjähriger Vergrabungen in der Nähe einer Brauerei beobachtet.
Zu Ponarth hatten wir bereits viele
Recherchen unternommen und so fiel es nicht schwer, die Rolle der
Brauerei Schönbusch aufzuklären. Ihre Keller und Lagerräume waren
1944 zur Einlagerung der riesigen Materialmengen herangezogen worden,
die aus den okkupierten Gebieten der UdSSR verschleppt wurden.
Das Lager der Schönbusch-Brauerei
gehörte zu einem Sonderauftrag des Reichsministers für die besetzten
Ostgebiete und stand unter der Leitung eines Oberregierungsrates
Bartling. Da es sich hier um einen Sonderauftrag des Ostministeriums
handelte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einlagerung des
Bernsteinzimmers in der Schönbusch-Brauerei auszuschließen. Hierfür
waren die tiefgreifenden persönlichen Differenzen zwischen
Ostminister Rosenberg und Reichskommissar Koch bestimmend. Bei den
beobachteten Vergrabungen hatte es sich um Schreibmaschinen
gehandelt, die natürlich nur noch schrottreif aufgefunden wurden.
Noch etwas spricht gegen die Version
einer Einlagerung im Ortsteil Ponarth. und das ist der Frontverlauf.
wie er in den Monaten Januar bis April 1945 bestand. In diesem
Zeitraum waren die sowjetischen Truppen gerade südlich von Königsberg
stets der Stadt am nächsten, und die faschistische Führung mußte zu
jeder Zeit mit einer erheblichen Verstärkung der Kräfte der
Sowjetarmee in diesem Abschnitt rechnen, sobald die deutschen Truppen
im Heilsberger Kessel (bei Lidzbark Warminski) südwestlich Königsberg
zerschlagen wären.
Aber nach Ponarth führte noch eine
andere Spur des Bernsteinzimmers. Im Februar 1967 berichtete die
polnische "Dzennik Ljudowy" über das Gespräch eines ihrer
Korrespondenten im Gefängnis mit Erich Koch. Darin habe Koch
angegeben, daß sich das Bernsteinzimmer in Kaliningrad im Bunker
unter der alten polnischen römisch-katholischen Kirche von Ponarth"
befinde. Dieser Bunker sei dann dem Erdboden gleichgemacht worden.
Außerdem wären darauf Bomben zur Explosion gebracht worden, um alle
Spuren zu vernichten.
Nun, an dieser Meldung stimmten gleich
mehrere Dinge nicht. Erstens war die Kirche in Ponarth evangelisch,
und zweitens war sie 1945 weder gesprengt noch bombardiert worden.
Sie blieb bis 1948 die evangelische Zentralkirche der bis dahin noch
in der Stadt und Umgebung verbliebenen Reste der deutschen
Bevölkerung. Dies bekundete kein Geringerer als der damalige Pfarrer
der Kirche. Mit der alten polnischen römisch-katholischen Kirche"
konnte dagegen nur die Steindammer Kirche im Zentrum der Stadt
gemeint sein. Auf sie traf das zu, was Koch hinsichtlich ihrer
Zerstörung dem Reporter der Zeitung berichtet hatte. Zeugen, die in
der Umgebung der Kirche wohnhaft gewesen waren, berichteten ebenfalls
von ihrer Zerstörung. Danach wurde die Kirche am Steindamm in den
ersten Apriltagen 1945 nicht durch Bomben oder Artilleriebeschuß,
sondern durch eine nicht erklärbare gewaltige Explosion dem Erdboden
gleichgemacht.
Schon sehr früh führten diese
letztgenannten Zeugenaussagen zu einer Überprüfung. In einem Gewölbe
der Ruine wurden tatsächlich eine Marmostatue, Gott Amor darstellend,
und ein stilvoller Sessel unter den Trümmern aufgefunden. An der
Rückseite des Sessels und am Sockel der Statue befanden sich
Metallschilder, auf denen jeweils eine Nummer und in kyrillischer
Schrift die Worte "Puschkin-Museum" entziffert werden konnten.
Offenbar hatte es sich bei dem Bunker am Steindamm, auf den Dr. Rohde
Professor Barsow bei einem gemeinsamen Fußweg hingewiesen hatte, um
eine Anlage gehandelt, die unter und unmittelbar neben der
Steindammer Kirche angelegt und als Depot genutzt war.
Solange das Geheimnis des
Bernsteinzimmers nicht völlig überzeugend gelüftet ist, wird auch
weiterhin allen ernstzunehmenden Hinweisen auf verdächtige Aktionen
der Faschisten in den letzten Wochen und Monaten ihrer Herrschaft in
Königsberg durch die zuständigen Organe Kaliningrads gründlich
nachgegangen werden.
So manches wertvolle, meist jedoch
beschädigte Kunstwerk aus Museen der Sowjetunion wurde bei dieser
jahrelangen Suche gefunden, doch vom Bernsteinzimmer ergab sich keine
neue Spur.

